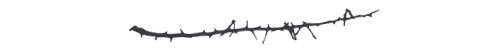Der Komponist
Das Leben von Krzysztof Penderecki
und seine kompositorische Entwicklung bis zur Lukaspassion
Landeskirchenmusikdirektor Hans-Joachim Rolf
Krzysztof Penderecki wurde am 23.11.1933 in Dębica (etwa 100 km östlich von Krakau) geboren. Er wuchs in einem katholisch geprägten Elternhaus auf, »… eher die Religion als die Musik bestimmte sein frühes Leben« (Robinson/Winold). Gleichwohl: Sein Vater, von Beruf Rechtsanwalt, war begeisterter Kammermusiker, seine Mutter Sängerin. Viel wurde musiziert in der Familie, und Krzysztof erhielt Klavier- und Geigenunterricht.
1951 begann Penderecki ein Studium der Philosophie, Kunst- und Literaturgeschichte an der Universität Krakau. Parallel dazu nahm er Unterricht am Konservatorium: Geige bei Stanislaw Tawroszewicz und Musiktheorie bei Franciszek Skolyszewski, über den Penderecki später sagte: »Ich verdanke ihm meine ganze musikalische Entwicklung, denn er war es, der mein Talent entdeckte und mich ermutigte.« (Ebd.)
weiterlesen...
So verließ er 1954 die Universität, um sich an der Staatlichen Musikhochschule in Krakau auf das Kompositionsstudium zu konzentrieren. Sein prägender Lehrer wurde Artur Malawski, der als bedeutendster polnischer Komponist nach Szymanowski galt und einige Jahre die polnische Sektion der International Society for Contemporary Music (ISCM) geleitet hatte.
Pendereckis kompositorische Entwicklung in der Studienzeit (1951-58) ist erstaunlich, bedenkt man die politische und kulturelle Isolation der Nachkriegszeit – außer in Polen war Musik der »Avantgarde« im Einflussbereich der Sowjetunion verpönt, und westliche Komponisten waren nicht zugänglich. Stravinskys »Sacre« z. B. hörte Penderecki erstmalig 1957, und Zugang zu Werken der Zweiten Wiener Schule erhielt er erst über Luigi Nono bei dessen Polenbesuch 1958.
Der Durchbruch
Für Aufsehen in der Fachwelt sorgte Penderecki, als er 1959 beim Wettbewerb des Polnischen Komponisten-verbandes für drei (anonym eingereichte) Werke alle drei Preise erhielt. »Der wirkliche Durchbruch zu internationaler Anerkennung gelang aber erst mit ‚Anaklasis‘ für Streicher und Schlagzeuggruppen …« (Müller), komponiert im Auftrag des Südwestfunks für die Donaueschinger Musiktage 1960 – Pendereckis erstes Werk, das seine Uraufführung in Westeuropa erlebte. Hier übertrug er »Strukturideen von Klang- und Geräuschflächen, die ihm durch die Arbeit im Warschauer Elektronischen Studio vertraut geworden waren, … mittels Streicher-Clustern auf Orchestermusik. Dabei stellte er … den blockhaft notierten Klangbändern die punktuelle Geräuschsphäre eines Schlagzeugapparats gegenüber.« (Danuser) »In weiteren Streicherkompositionen… entwickelte er diese Satztechniken weiter, indem er mit vielerlei Spielweisen den Geräuschklang belebte und die unterschiedlich breiten Cluster-Bänder mittels Glissandi zu einer Polyphonie von Schichten steigerte. Nachdem er verwandte Konzeptionen in ‚Dimensionen der Zeit und der Stille‘ (1959/61) auch im Bereich der phonetischen Chorkomposition erprobt und die bruitistische Tendenz dieser Ästhetik in ‚Fluorescences‘ für Orchester (1961/62) zu einem Höhepunkt geführt hatte, wandte er sich 1962 der geistlichen Musik zu, mit seinem ‚Stabat Mater‘ für drei Chöre a cappella.« (Danuser)
Literaturquellen
Danuser, Hermann (1984): Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft Bd. 7. Laaber : Laaber-Verlag.
Müller, Karl-Josef (1973): Informationen zu Pendereckis Lukas-Passion. Schriftenreihe zur Musikpädagogik. Frankfurt/Main: Diesterweg.
Robinson, Ray / Winold, Allen (1983): A Study of the Penderecki „St. Luke Passion”. Celle: Moeck.
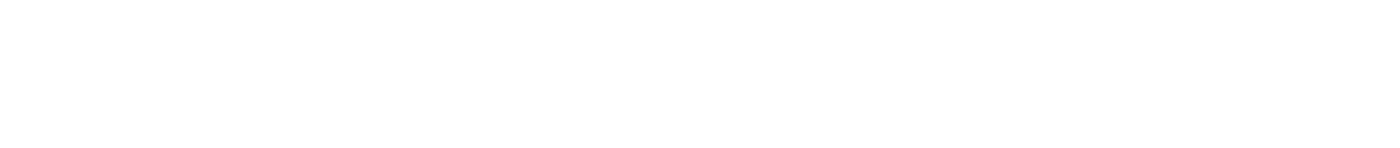
Musik
I. Zur Musik der Lukaspassion
Landeskirchenmusikdirektor Hans-Joachim Rolf
Die Lukaspassion (vollständiger Titel: »Passio et mors Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam«) komponierte Krzysztof Penderecki in den Jahren 1964 bis 1966 als Auftragswerk des Westdeutschen Rundfunks zur 700-Jahrfeier des Doms zu Münster/Westfalen (Uraufführung dort am 30. März 1966), wobei er das 1962 entstandene »Stabat mater« (dreichörig a cappella) unverändert übernahm. Zusätzlich zu den drei gemischten Chören ist das Werk mit Knabenchor, Sprecher (Evangelist), drei Vokalsoli (Sopran, Bariton, Bass) und großem Orchester besetzt.
Die Grundstruktur
Dem Werk liegt eine symmetrische Zwölftonreihe zugrunde:
weiterlesen...
Die ersten vier Töne entstammen der polnischen Kirchenhymne »Świȩty Boże« (Robinson/Winold). Auffälliger ist allerdings die (permutierte) b-a-c-h-Figur am Ende – keineswegs ein Zufall, sondern »Grundmotiv des ganzen Werkes« (Müller). Diese Bemerkung bezieht sich vordergründig auf die Struktur der Reihe, weist aber auch programmatisch auf die Auseinandersetzung mit Johann Sebastian Bach hin: Es lässt sich kaum vermeiden, schon die Besetzung des Eingangschores mit Knabenchor (!), drei gemischten Chören und vollem Orchester als bewusste Anlehnung an Bachs Matthäuspassion zu werten. Auch in der formalen und textlichen Anlage zeigen sich Parallelen: Dem protestantischen Choral (im Knabenchor) bei Bach steht bei Penderecki der lateinische Passionshymnus »Vexilla regis prodeunt« gegenüber.
Die Textdisposition des gesamten Werkes folgt ebenfalls dem Vorbild Bachs, indem der Bibeltext durch andere Texte ergänzt und kommentiert wird. Allerdings verzichtet Penderecki auf zeitgenössische Dichtung, vielmehr wählt er gezielt Psalmen und weitere Bibeltexte, Hymnen und Teile der Karfreitags-Liturgie aus. Er zeigt sich hier als liturgisch und theologisch fundierter Komponist.
Um die unmittelbare Dramatik des Geschehens zu erhöhen, verdichtet er die Handlung, indem er bestimmte Passagen des Passionsberichtes streicht. Auch bleibt er konsequent bei der lateinischen Sprache – bemerkenswert, da das II. Vatikanische Konzil 1963 die Verwendung der Landessprache in der Liturgie beschlossen hatte.
Insgesamt gelingt Penderecki hiermit ein ebenso aktuell ergreifender wie zeitloser Textentwurf.
Neue Stilelemente
In der Lukaspassion arbeitet Penderecki mit allen Stil- und Klangmitteln der damaligen Avantgarde, die er in seinen vorherigen Orchester- und Chorwerken entwickelt und erprobt hatte (s. o.): Clusterbildung, Vierteltöne, vielfältige Verfremdung (besonders des Streicherklangs) durch unkonventionelle Spielweise sowie Verwandlung des Klanges in Geräusch, sowohl im Orchester als auch im Chor. Spott und Schläge, Hohngelächter und Pfiffe sind nicht nur Gegenstand der Betrachtung, sie werden von den Chören real ausgeführt. »Die musikalische Gestaltung der Chöre umfasst die Musikalisierung verschiedener Sprachlaute einschließlich geräuschhafter Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme …, die im Kontext der Verspottungsszene realistisch die Äußerung der Volksmenge darstellen.« (Middelberg)
Diesen Realismus kann man freilich auch als Verrat an der Idee einer „absoluten“ avantgardistischen Musik deuten: »Sprach- und Klangkomposition sind hier keine ästhetischen Zwecke, sondern Mittel, um einen altüberlieferten Gehalt in moderner Erscheinungsform zu realisieren. So ist die Passage, bei der die Chöre auf das Phonem T ein vielfach zerhacktes Geräuschfeld vortragen und in Hohngelächter und Pfeifen ausbrechen …, nichts anderes als eine Klangillustration, ein stilisierter Realismus, der mit Geräuschklängen malt, was der Evangelist zuvor spricht… In der Lukaspassion [erscheint] Klangkomposition von einer Funktion der Avantgardekunst zu einem Mittel der Tradition verkehrt. Ein solcher Widerspruch, unverträglich mit einem emphatischen Begriff von Moderne, verlangte nach Auflösung. Und in der Tat war Penderecki unter den (einstmaligen) Avantgardisten, der in den siebziger Jahren … so zu schreiben begann, als hätte es seit dem 19. Jahrhundert keine Diskontinuität der Geschichte gegeben.« (Danuser)
Wiedergeburt und Erneuerung einer historischen Gattung
Wie immer die Lukaspassion im Kontext der Musikästhetik, der Kompositionsgeschichte und der Biographie des Komponisten zu bewerten sein mag: Das Passionsoratorium, eine seit dem 18. Jahrhundert nahezu bedeutungslose Gattung, erlebt durch Penderecki eine phänomenale Wiedergeburt und einen Höhepunkt. Die Ausdrucksstärke des Werkes ist kaum zu übertreffen, und es fasziniert auch 50 Jahre nach seiner Entstehung, trotz – oder gerade wegen! – seiner komplexen, für viele Hörer noch immer ungewohnten Klänge.
Pendereckis Intention geht dabei über die Darstellung des historischen Stoffes weit hinaus: »Die Passion ist das Leiden und der Tod Christi, aber sie ist auch das Leiden und der Tod von Auschwitz… In diesem Sinne soll sie nach meinen Absichten und Gefühlen universellen, humanistischen Charakter … haben.« (Müller)
Literaturquellen
Danuser, Hermann (1984): Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft Bd. 7. Laaber : Laaber-Verlag.
Middelberg, Bettina (2008): „Musik als Sprache – Sprache als Musik“. In: RAAbits Musik 57. Stuttgart: RAABE.
Müller, Karl-Josef (1973): Informationen zu Pendereckis Lukas-Passion. Schriftenreihe zur Musikpädagogik. Frankfurt/Main: Diesterweg.
Robinson, Ray / Winold, Allen (1983): A Study of the Penderecki „St. Luke Passion”. Celle: Moeck.
Umbach, Klaus (1987): „Mit Gloria und Glykol in den Rückwärtsgang – SPIEGEL-Redakteur über Krzysztof Penderecki und die Neue Musik“ (mit Interview). In: Der SPIEGEL, 05.01.1987, S. 142ff.
Internetquellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Penderecki
http://www.klassikakzente.de/krzysztof-penderecki/biografie
II. Geschichte der Passionsvertonung
Kirchenmusikdirektor Carsten Zündorf
Die Historie der Passionsvertonungen ist eng verknüpft mit der jeweils vorherrschenden Theologie, der Volksfrömmigkeit sowie der Geistes-, Sozial- und Kunstgeschichte.
Vom Weltenherrscher zum Schmerzensmann – frühchristliche Passionsspiele
Wurde in der frühchristlichen Kirche Christus als Pantokrator – als Weltenherrscher – und nicht als der Gekreuzigte und das Kreuz selbst als Triumphkreuz oder Kreuz der Verklärung dargestellt, so wandeln sich die bildlichen Darstellungen etwa mit Beginn der Gotik im 12. Jahrhundert zu Abbildungen des Gekreuzigten, des Schmerzensmannes. Mit der Ausbreitung der Theologie des Franziskaner-Ordens wird diese Wandlung in der Westkirche manifestiert. So treten im ausgehenden 12. Jahrhundert die ersten Passionsspiele neben die um zweihundert Jahre älteren Osterspiele, und der Karfreitag gewinnt gegenüber dem Osterfest an Bedeutung.
weiterlesen...
Woher kommt der Passionsgesang?
Die Anfänge der Passionsliturgie und damit die Wurzeln des Passionsgesanges reichen bis ins fünfte Jahrhundert zurück. Die in Erzählung und direkte Rede aufgeteilten Passionsberichte nach den vier Evangelisten wurden in der Karwoche im Rahmen der Messgottesdienste als Evangelienlektionen vorgetragen. Bereits in der Mitte des 5. Jahrhunderts wurde die Lesung der Passionsgeschichte nach dem Evangelisten Matthäus auf den Palmsonntag, diejenige nach Johannes auf den Karfreitag festgelegt.
Die Lesungen der Passionen erfolgte nach bestimmten Lektionstönen; mittels differenzierter Tonhöhen wurden die erzählenden Texte von denjenigen mit direkter Rede unterschieden, und auch verschiedene Personen konnten mit unterschiedlich hohen Lektionstönen dargestellt werden: der Evangelist als Zeichen der Mäßigung in mittlerer Lage, die Rede Jesu als Zeichen der Demut in tiefer und die Partien des Volkes als Zeichen des Zornes in hoher Lage. Noch allerdings wird trotz der Unterscheidungen die Lesung nur von einem einzigen Lektor vorgetragen.
Mitleid statt Lehre im Mittelalter
Etwa vom 10. Jahrhundert an wird an besonderen Stellen vom Lektionston abgewichen, z.B. bei den Worten Jesu am Kreuz. Die bis dahin lehrhafte Passionslesung (doctrina) beginnt sich zur mitleidsvollen Passion (compassion) zu wandeln. Im späten 12. Jahrhundert dann wird die Lesung auf mehrere Vortragende aufgeteilt. Es entsteht die Forderung nach ausdrucksvoller Gestaltung. In den Kirchenordnungen finden sich Formulierungen, die für den Passionsvortrag eine tristitia compassionis, also eine Traurigkeit des Mitleidens, fordern ebenso wie Hinweise darauf, dass die Worte mortem autem crucis mit weinender Stimme – flebili voce – vorzutragen seien oder die wörtliche Rede Jesu in sanftem Ton und die Rufe der Turbae mit lauter und rauer Stimme.
Mit all diesen Differenzierungen hebt sich damit die Passionslesung deutlich von allen anderen Evangelienlesungen ab.
Neue Ausdrucksmöglichkeiten durch Mehrstimmigkeit
Der Vortrag der Passionslesung durch mehrere Sänger eröffnet nun auch die Möglichkeit des musikalischen Zusammenwirkens. Das geschieht bei den Chören der Jünger und des Volkes zwar gemeinsam, aber zunächst noch einstimmig.
Ab etwa 1430 nehmen neue theologiegeschichtliche Entwicklungen Einfluss auf die Mehrstimmigkeit der Passion. War bisher von der compassion die Rede, so tritt an deren Stelle nun zunehmend die imitatio (das Nachahmen des Leidens Christi) oder sogar die identificatio (die Identifikation mit dem Leiden Christi).
Mehrstimmige Passionsvertonungen treten in zwei Grundformen auf: zum einen die responsoriale Passion, in der die einstimmig vertonten Partien der Soliloquenten den mehrstimmigen von Personengruppen gegenüberstehen; zum anderen die durchkomponierte Passion, in der der vollständige Text mehrstimmig gesetzt ist. Selten vertont eine durchkomponierte Passion nur den Bericht eines einzigen Evangelisten; häufiger ist eine sogenannte Evangelienharmonie (summa passionis), eine Kompilation der Erzählung nach allen vier Evangelisten anzutreffen. Oft wird die durchkomponierte Passion mit Rahmenchören freier Textdichtung versehen.
Reformation – back to the roots?
Die Reformation hat sich auf die Weiterentwicklung der für den liturgischen Gesang bestimmten Passionsvertonungen zunächst kaum ausgewirkt. Lutheraner wie Katholiken führten zunächst die bisherigen Praktiken fort. Erst mit der an das Tridentiner Konzil anschließenden Gegenreformation beginnen sich die lutherischen und katholischen Passionspraktiken zu unterscheiden.
Martin Luthers Kreuzestheologie nimmt entscheidenden Einfluss auf die Passionsvertonungen im deutschen evangelischen Gottesdienst des 16. Jahrhunderts. Luther verwirft die mittelalterliche compassio und identificatio: »Du möchtest selbst mitleidend handeln? Aber Christus leidet mit dir, und du, Mensch, möchtest mit ihm und nicht mit dir selbst Mitleid haben?« Damit bezieht sich Luther in gewisser Weise zurück auf das augustinische Passionsverständnis der doctrina, der lehrhaften Passion.
Die ersten reformatorischen responsorialen Passionen stammen von Luthers Freund und Mitarbeiter Johann Walter. Dabei handelt es sich weniger um Kompositionen als um schematisierte, nach vorreformatorischen Vorbildern geschaffene Klangfolgen. Neu sind bei Walter die Erweiterung des Satzes von der Drei- zur Vierstimmigkeit sowie die eindeutig notierte Rhythmik.
In der Mitte des 16. Jahrhunderts werden den protestantischen Passionen mehrstimmige Rahmenchöre hinzugefügt, das exordium und die confirmatio. Diese Form ist auch Vorbild für die drei Passionen nach den Evangelisten Matthäus, Lukas und Johannes von Heinrich Schütz, komponiert in den Jahren 1665/66 für die Liturgie der Dresdner Hofkirche. Im Gegensatz zu seiner Weihnachts- und Auferstehungshistorie verzichten die Passionen ganz auf Generalbass und weitere begleitende Instrumente. Das Rezitativ des Evangelisten knüpft an alte Rezitationstöne an, verändert diese jedoch bei bedeutsamen Textstellen. Gerahmt werden die Schützschen Passionen durch einen mehrstimmig gesetzten introitus und durch eine ebenfalls mehrstimmige conclusio.
Neue Strömungen und ihre Passionsformen
Im 17. Jahrhundert entwickelt sich vor dem Hintergrund der sich von der lutherisch-orthodoxen Strenggläubigkeit abkehrenden Frömmigkeit und dem Aufkommen des Pietismus die oratorische Passion. Damit löst sich auch die evangelisch-lutherische von der katholischen Passion.
Auf evangelischer Seite treten im Wesentlichen drei Elemente hinzu, die auch dem lutherischen Gemeindeverständnis geschuldet sind: Es werden Strophen evangelischer Gemeindelieder eingefügt, um der Gemeinde im Passionsgeschehen eine Stimme zu geben; ferner treten zusätzliche Texte in freier Dichtung hinzu, die als Arien vertont werden. Schließlich werden Introitus und Conclusio zu größeren Rahmenchören ausgebaut. Dieser neue Typus der Passionsvertonung entwickelt sich ungebrochen weiter und findet seinen Höhepunkt in den Passionen Johann Sebastian Bachs. Zur Vollendung der Bachschen Großform, die Johann Mattheson in seiner Schrift »Der vollkommene Capellmeister« (1739) die oratorisch-poetische Passion nennt, fehlen nun noch von Chor und Orchester vorzutragende Chöre und Choräle, oratorische Rezitative, die vom ursprünglichen Rezitationston vollkommen frei sind sowie große da-capo-Arien und Duette, die durch die obligate Mitwirkung von Instrumenten konzertanten Charakter bekommen. Einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu den Bachschen Passionen nach Johannes und Matthäus markiert die Markus-Passion des Hamburger Opernkomponisten Reinhard Keiser. Diese Form der oratorischen Passion blieb in Hamburg bis ins späte 18. Jahrhundert hinein erhalten, vor allem durch Georg Philipp Telemann, der als Leiter der Musik an den fünf Hauptkirchen in mehr als vierzig Dienstjahren 46 Passionen verfasste, von denen 23 noch nachzuweisen sind.
Neben die oratorische Passion tritt ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts das Passionsoratorium. Dieser Gattung liegt nun nicht mehr der biblische Bericht zugrunde, sondern freie Dichtung, die den biblischen Bericht betrachtend auslegt. Der biblische Bericht wird gewissermaßen als bekannt vorausgesetzt. Auch treten an die Stelle des Evangelisten und der handelnden Personen allegorische Figuren wie z.B. die gläubige Seele oder die Tochter Zion. Der wohl am meisten vertonte Text dieser Art stammt vom Hamburger Dichter Heinrich Brockes: »Der für die Sünden der Welt gemarterte und sterbende Jesus« (»Brockes-Passion«).
Die Auflösung liturgischer Bindung
Diese Form der Passionskantate oder des Passionsoratoriums löste um die Wende zum 19. Jahrhundert schließlich die liturgisch gebundene Form der oratorischen Passion ab. Bereits 1766 hatten die Leipziger Kirchenbehörden verfügt, dass der liturgische Vortrag einer Passion im Gottesdienst nur noch als Lesung zu erfolgen habe, woran sich die Gemeinde mit dem Singen von Passionsliedern beteiligen sollte.
Beispiele für Passionsoratorien einer modern-aufgeklärten Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts sind z.B. »Christus am Ölberge« von Ludwig van Beethoven und »Des Heilands letzte Stunden« von Louis Spohr.
Einen Meilenstein in der Geschichte der Passionsmusiken stellt die Wiederaufführung der Bachschen „Matthäus-Passion“ im Frühjahr 1829 durch die Berliner Singakademie unter der Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy dar. Das Werk erklang in stark gekürzter und von Mendelssohn bearbeiteter Form. Diese Aufführung löste die Bachsche Passion vollkommen aus ihrem ursprünglichen liturgischen Kontext und schuf eine konzerthafte Trennung von Aufführenden und Zuhörern.
Rückkehr in den Gemeindegottesdienst
Im 20. Jahrhundert ist unter den in den Nachkriegsjahren entstandenen Kompositionen vor allem der »Passionsbericht des Matthäus« von Ernst Pepping zu nennen, entstanden 1949/50; ein komplexes Werk für zwei vierstimmige Chöre a cappella. Dem ersten Chor fällt die Aufgabe zu, den Evangelistenbericht zu singen, der zweite Chor übernimmt darüber hinaus deutende und theologisch ergänzende Funktionen.
Ebenfalls unmittelbar nach Kriegsende, in den Jahren 1945-1948, komponierte der Schweizer Komponist Frank Martin sein Oratorium »Golgotha«, angeregt durch die Radierung »Die drei Kreuze« von Rembrandt. Als Textgrundlage verwendete Martin eine Passionskompilation aus den vier Evangelien und fügt anstelle von Arien und Chorälen Texte des Kirchenvaters Augustin ein, die als kontemplative Ruhepunkte wirken.
Die in den Jahren 1963-1965 geschaffene Lukaspassion des polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki ist trotz ihres lateinischen Textes kein liturgisches, wohl aber ausgesprochen geistliches Werk, in welchem die schrecklichen Erfahrungen Polens während der vierziger Jahre zum Ausdruck kommen: Das Leiden Jesu erscheint vor dem Hintergrund des Holocaust unter Gräbern von Katyn, das »Miserere mei« ist das Leitmotiv des Werkes. Die lateinischen Texte sind den Kapiteln 22 und 23 des Lukasevangeliums (vereinzelt auch anderen Evangelien) sowie der römisch-katholischen Messliturgie entnommen. Zwischen Jesu Anrede an seine Mutter am Kreuz und die Schilderung der plötzlichen Finsternis ist ein »Stabat mater« eingeschoben, der zuerst komponierte Abschnitt des gesamten Werkes. Neben zur Zeit der Entstehung avantgardistischen Mitteln wie Zwölftonreihen, Geräuscheffekten und Clustern verwendet Penderecki auch alte Formen wie z. B. die der Passacaglia. Eindrucksvoll sind die reiche, von Bläsern und Schlagwerk dominierte Orchesterbesetzung sowie die Aufteilung des Vokalparts auf drei Chöre.
Der Penderecki-Schüler Oskar Gottlieb Blarr schuf in den frühen 1980er Jahren unter dem Eindruck eines vorausgegangenen zweijährigen Aufenthaltes in Israel die »Jesus-Passion«, oratorische Szenen in drei Teilen für Soli, Chor, Kinderchor und großes Orchester. Die Texte sind vorwiegend dem alten, aber auch dem neuen Testament entnommen. Darüber hinaus verarbeitete Blarr Texte aus dem Talmud und aus moderner jüdischer und christlicher Lyrik. Analog zur Textauswahl verwendete Blarr auch jüdisches und muslimisches Musikgut.
Freiheit und Minimalismus
Gerd Zacher bemerkt zu seiner im Jahre 1968 entstandenen Passionsmusik nach Lukas »700 000 Tage später« für 12 bis 28 Mitwirkende: »Wer es heute, 700 000 Tage später, unternimmt, eine Passionsmusik zu verfassen, der wird zunächst einmal völlig verstummen. Wenn er dann die Sprache wiederfindet, wird es eine andere Sprache sein, als er bisher kannte. Er wird sie noch nicht sprechen oder singen können, sondern vorerst nur stammeln.« Folgerichtig ist die Notation der Passion zumeist verbal, musikalische Vollzüge werden nur angedeutet, dem Interpreten viele Freiheiten gelassen. Es existieren nur Stimmen, keine Partitur, die Anleitung durch einen Dirigenten ist nicht vorgesehen.
Getreu seinem Bekenntnis, dass »Stille immer vollkommener als Musik« sei, komponiert Arvo Pärt seine »Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem« mit in mehrfacher Hinsicht minimalistischen Mitteln. Die Melodik ist von der Gregorianik angeregt, die wenigen solistisch besetzen Instrumente (Violine, Oboe, Violoncello, Fagott und Orgel) sind simultan oder alternierend, gewöhnlich in gegenläufiger Bewegung zur Singstimme eingesetzt. Die Wirkung von Pärts Johannespassion entfaltet sich gerade durch die bewusst gewählte kunstvolle Ärmlichkeit der Mittel.
Weitere Beispiele für Passionsvertonungen auch bis in das 21. Jahrhundert hinein stammen unter anderem von Sofia Gubaidulina (»Johannespassion« in russischer Sprache, 2000) und Wolfgang Rihm (»Deus passus« nach ausgewählten Texten des Lukasevangeliums, 2000).
Die Weltgeschichte fordert neu heraus
Die Passionsvertonungen sind zu allen Zeiten stets eng mit dem Wandel theologisch-liturgischer und kirchengeschichtlicher Anschauung verknüpft gewesen.
Im 20. und 21. Jahrhundert standen und stehen Komponisten vor der Herausforderung, das Passionsgeschehen vor dem Hintergrund zweier Weltkriege, des Holocaust, von Fragen nach sozialer Gerechtigkeit in der Welt, des Dialogs und auch der Konflikte der monotheistischen Religionen sowie der Globalisierung neu zu verorten und zu vertonen.
Literaturquelle
nach Fischer, Kurt von (1997): Die Passion: Musik zwischen Kunst und Kirche. Kassel: Bärenreiter.
„DIE LUKASPASSION IST EINFACH ANDERS“
Josephine Werth vom Team VISION KIRCHENMUSIK besuchte den Knabenchor Hannover und fragte die jungen Sänger nach ihren Erlebnissen mit dem Werk von Krzysztof Penderecki.
![]()
 „Bevor wir die Lukaspassion gesungen haben, kannte ich diese Art von Musik noch nicht. Und jetzt finde ich sie richtig toll! Zwischendurch spricht oft ein Mann einen lateinischen Text, so ganz dramatisch, zum Beispiel, dass Jesus stirbt. Obwohl man den Text nicht versteht merkt man, dass es da gerade um etwas sehr Wichtiges geht.“ – Béla
„Bevor wir die Lukaspassion gesungen haben, kannte ich diese Art von Musik noch nicht. Und jetzt finde ich sie richtig toll! Zwischendurch spricht oft ein Mann einen lateinischen Text, so ganz dramatisch, zum Beispiel, dass Jesus stirbt. Obwohl man den Text nicht versteht merkt man, dass es da gerade um etwas sehr Wichtiges geht.“ – Béla
 „Spannend finde ich die Stelle, an der wir die ganze Zeit ein Wort singen und immer lauter werden. Dann hören wir plötzlich mittendrin auf. Das Wort wird gar nicht zu Ende gesungen und auf einmal wird es ganz leise. Alle Chöre sind weg und in die Stille kommt ein richtig schräger Akkord vom Orchester. Den finde ich cool.“ – Johannes
„Spannend finde ich die Stelle, an der wir die ganze Zeit ein Wort singen und immer lauter werden. Dann hören wir plötzlich mittendrin auf. Das Wort wird gar nicht zu Ende gesungen und auf einmal wird es ganz leise. Alle Chöre sind weg und in die Stille kommt ein richtig schräger Akkord vom Orchester. Den finde ich cool.“ – Johannes
 „Ich hab ganz am Anfang Gänsehaut, wenn sich die Spannung, die sich vor dem ersten Ton bei uns und beim Publikum aufgebaut hat, auflöst. Und ganz besonders finde ich auch die Stellen, an denen es ein Stimmengewirr gibt – ab und zu kommt dann ein hoher Ton und der trifft einen wie ein Strahl.“ – Johann
„Ich hab ganz am Anfang Gänsehaut, wenn sich die Spannung, die sich vor dem ersten Ton bei uns und beim Publikum aufgebaut hat, auflöst. Und ganz besonders finde ich auch die Stellen, an denen es ein Stimmengewirr gibt – ab und zu kommt dann ein hoher Ton und der trifft einen wie ein Strahl.“ – Johann
 „Einmal haben wir eine sehr lange Pause und dann kommen richtig laute Trommeln. Die sind gar nicht so groß, aber richtig laut und dann steht man zwar zum Einsatz mit den anderen auf, aber man guckt manchmal nicht zum Dirigenten, sondern noch zu den Trommeln. Und da habe ich immer Gänsehaut, ob ich es schaffe, rechtzeitig zum Dirigenten zu gucken.“ – Bruno
„Einmal haben wir eine sehr lange Pause und dann kommen richtig laute Trommeln. Die sind gar nicht so groß, aber richtig laut und dann steht man zwar zum Einsatz mit den anderen auf, aber man guckt manchmal nicht zum Dirigenten, sondern noch zu den Trommeln. Und da habe ich immer Gänsehaut, ob ich es schaffe, rechtzeitig zum Dirigenten zu gucken.“ – Bruno
 „An den lauten Stellen kommt so ein gewisses Vibrieren rein. Zum Beispiel in der Situation, in der Jesus verhaftet wird, oder wo Judas entlarvt wird. Da zischen die Chöre dann „Judas“ und man hört das „s“ noch sehr lange. Die Stelle ist mir gut im Kopf geblieben, weil sie auch wirklich sehr, sehr laut ist.“ – Max
„An den lauten Stellen kommt so ein gewisses Vibrieren rein. Zum Beispiel in der Situation, in der Jesus verhaftet wird, oder wo Judas entlarvt wird. Da zischen die Chöre dann „Judas“ und man hört das „s“ noch sehr lange. Die Stelle ist mir gut im Kopf geblieben, weil sie auch wirklich sehr, sehr laut ist.“ – Max
 „Sehr beeindruckend finde ich es, wenn es erst sehr laut ist und dann ganz abrupt und unerwartet auf einmal still wird und man nur noch den Klang nachhallen hört. Insgesamt ist die Lukaspassion sehr schwierig zu singen. Die Einsätze zu finden ist schwer, es gibt viele verschiedene Vorzeichen, und wenn man einmal seine Stimme verloren hat, ist es sehr schwer sie wiederzufinden, weil es so viele verschiedene Klänge auf einmal sind.“ – Lukas
„Sehr beeindruckend finde ich es, wenn es erst sehr laut ist und dann ganz abrupt und unerwartet auf einmal still wird und man nur noch den Klang nachhallen hört. Insgesamt ist die Lukaspassion sehr schwierig zu singen. Die Einsätze zu finden ist schwer, es gibt viele verschiedene Vorzeichen, und wenn man einmal seine Stimme verloren hat, ist es sehr schwer sie wiederzufinden, weil es so viele verschiedene Klänge auf einmal sind.“ – Lukas
Theologie
I. Zur Theologie der Lukaspassion
Hon.-Prof. Dr. Klaus Grünwaldt
Für die evangelische Theologie und Kirche ist der Karfreitag der höchste Feiertag. Die Rechtfertigung des Sünders aus Glauben, Luthers Wiederentdeckung, hat ihren sachlichen Grund im Tod Jesu, der am Kreuz stellvertretend den Tod erleidet und damit unsere Sünde trägt, hinfort nimmt.
Diese Sicht der Dinge wird seit einiger Zeit heftig hinterfragt. Schon Goethe – zugegeben ein lausiger Theologe – war das Kreuz »wie Gift und Schlange zuwider«. Heute fragt bzw. kritisiert man u.a.:
- Ist das Kreuz nicht ein sehr lebensfeindliches Symbol, wo Gott doch ein Freund des Lebens ist? Ja, ist der evangelische Glaube vielleicht sogar nekrophil?
- Sollen wir nicht stattdessen lieber Symbole des Lebens in den Mittelpunkt unserer Verkündigung stellen?
Die Rede vom Opfertod Christi vermittelt ein schreckliches Gottesbild: Ein Gott, der seinen Sohn als Opfer verlangt, jedenfalls anerkennt. Gerade Frauen nehmen am despotischen Gottesbild Anstoß.
Die Rede vom stellvertretenden Sühnetod Christi ist doch nur eine von vielen möglichen Interpretationen des Todes Jesu. Kann man ihn nicht besser als Lebenshingabe aus Liebe deuten?
weiterlesen...
Die Rede von der Schuld und der Sünde, die Jesus auf sich nimmt, macht den Menschen ein schlechtes Gewissen, drückt sie nieder. Will Gott aber nicht, dass wir fröhlich sind und aufrecht gehen?
Eine Mutter kritisiert: »Gott hat mit voller Absicht seinen Sohn Folterknechten und Henkern ausgeliefert. Eine entsetzliche Geschichte. Meinen Kindern müsste ich klarmachen, dass ihre Eltern niemals derartiges mit ihnen tun werden.« Und sie fragt: »Warum eigentlich sollte Jesus leiden? Ist Gott nicht allmächtig, so dass ein Wort genügt hätte, um alles zu vergeben?«
Die Lukaspassion von Krzysztof Penderecki bietet Anlass und Gelegenheit, sich mit diesen Fragen neu auseinanderzusetzen. Dabei kann die Textauswahl aus dem Evangelium des Lukas – angereichert mit Passagen aus dem Johannesevangelium, den Psalmen, den Klagen des Jeremia, liturgischen Texten der Karwoche und lateinischen Hymnen wie dem »Stabat Mater«, die Diskussion schärfen und beflügeln.
II. Die sieben Worte Jesu am Kreuz
Hon.-Prof. Dr. Klaus Grünwaldt
Letzten Worten sterbender Menschen wird eine besondere Bedeutung beigemessen. Von Goethe wird überliefert, er habe »mehr Licht« gefordert, und man interpretiert dies als Ruf nach mehr Aufklärung der Menschen. Luthers Worte »Wir sind Bettler, das ist wahr« nimmt man als schlagende Zusammenfassung seiner reformatorischen Botschaft. Natürlich werden auch die letzten Worte Jesu, seine Worte am Kreuz, in den christlichen Kirchen besonders gewürdigt.
Nach gängiger Tradition sind es sieben Worte. Ich gebe sie nicht in der historischen Reihenfolge der Passionsgeschichte, sondern in der Reihenfolge der Überlieferung dar, beginnend mit dem ältesten Evangelium:
weiterlesen...
1. Markus 15,34; Matthäus 27.46
»Eli, eli, lama sabachtani – Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«
Diesen Satz kann man in zwei Perspektiven lesen bzw. hören. Zum einen ist der Satz ein erschütterndes Zeugnis, da er die Verzweiflung des Sohnes über den Vater zum Ausdruck bringt, der die Bitte »Lass den Kelch an mir vorübergehen« nicht erfüllt. Mehr noch: Der Sohn stirbt allein, verlassen, ja gottverlassen am Kreuz. Interpretiert man die Worte Jesu von der christlichen Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit (Trinität) her, dann geht in dieser Stunde ein Riss durch die Trinität. Entsprechend dichtet der Liederdichter Johannes Rist 1641 in Fortschreibung einer Strophe von Friedrich Spee: »O große Not, Gott selbst liegt tot.« Unser Gesangbuch hat das abgemildert in »Gotts Sohn liegt tot« und dem Wort damit den Stachel genommen. In dem Wort Jesu können sich alle die wiederfinden, die in ihrem Leid an Gott verzweifeln, die angesichts von Hunger, Krankheit, Terror und Ungerechtigkeit nicht mehr daran glauben können, dass ein liebender Gott die Geschicke der Welt lenkt. Jesus selbst ist an ihrer Seite.
Zum anderen ist dieses Wort ein Psalmenzitat. Mit dem Verlassenheitsschrei beginnt Psalm 22, ein Klagepsalm eines Einzelnen. Der Psalm endet damit, dass der Beter oder die Beterin seiner/ihrer Rettungs-Gewissheit Ausdruck gibt. In Vers 22 heißt es am Ende: »Du hast mich erhört« – jedenfalls gemäß dem überlieferten hebräischen Text. Darauf folgen überschwängliche Worte des Lobes und Dankes und eine Aufforderung an andere, ebenfalls Gott zu loben. Insofern, als auch Verstorbene in der Reihe derer genannt werden, die Gott anbeten, kann man hier Auferstehungshoffnung formuliert finden. Soll der Verlassenheitsschrei also letzten Endes von Jesu Auferstehungshoffnung Zeugnis geben?
2. Lukas 23,34
Dieses und die beiden folgenden Wörter stammen aus dem Lukasevangelium, das heißt, der Passionsgeschichte nach Lukas. Sie sind dem Sondergut des Lukas zuzurechnen, kommen also nur im Lukasevangelium vor.
Die Lukaspassion zeichnet das Sterben Jesu als Sterben eines Unschuldigen, eines Gerechten, ja eines Märtyrers. Umso mehr bewegt die Leser*innen die Vergebungsbitte Jesu. Da nicht genau gesagt ist, wer mit den »ihnen« gemeint ist, muss man das Wort auf alle beziehen, die in das Sterben Jesu verwickelt sind: Zunächst diejenigen, die im Moment aktiv sind, also die Henker, aber ebenso ist an die Machthaber und Soldaten, Ankläger, Claqueure und stumme Zuschauer, dann auch die Jünger*innen und nicht zuletzt Judas (in den der Satan gefahren ist). Da sie nicht den verborgenen Plan Gottes kennen, wissen sie nicht, was sie tun. Da Jesus als Märtyrer stirbt, hat seine Bitte, sein Gebet besonderes Gewicht.
Auch wenn Lukas die Heilsbedeutung des Todes Jesu deutlich weniger betont als die übrigen Synoptiker und vor allem der Apostel Paulus, verbindet die hier ausgesprochene Vergebungsbitte das Sterben Jesu mit der Sündenvergebung.
3. Lukas 23,43
»Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.«
Jesus wird mit zwei Verbrechern zusammen gekreuzigt. Während der eine Jesus verspottet, indem er ihn auffordert, sich selbst und den beiden zu helfen, weist der andere ihn zurecht. Er erklärt, schuldig zu sterben, während Jesus nichts Unrechtes getan habe. Und er bittet ihn: »Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst.« Diesem letzteren gilt das Wort.
Die Szene unterstreicht die lukanische Zeichnung der Passionsgeschichte als Sterben eines Gerechten. Darüber hinaus macht Jesus deutlich, dass es, um ins Paradies zu kommen, gewisser Einsichten bedarf: der Einsicht in die eigene Schuld, durch die man sein Schicksal verdient hat, aber auch die Erkenntnis, dass Jesus als Unschuldiger gestorben ist. Schließlich geht aus dem Wort hervor, dass Jesus die Vollmacht hat zu bestimmen, wenigstens aber zu erkennen, wer den Weg mit bzw. zu Jesus ins Paradies findet – und wer nicht.
Bemerkenswert ist, dass das Wort davon ausgeht, dass der Mit-Gekreuzigte nicht erst bis zum »Jüngsten Tag« warten muss, um ins Paradies zu kommen, wie es die traditionelle Auffassung war, sondern dass es gleichsam direkt vom Kreuz »in den Himmel« geht.
4. Lukas 23,46
»Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände.«
Das Wort macht die innige Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn deutlich und unterscheidet sich in diesem friedvollen Sterben wesentlich von dem Verlassenheitsruf Markus 15,34 (oben 1.). Hier stirbt nicht ein Verlassener, ein Verzweifelter, sondern einer, der mit sich und seinem Gott im Reinen ist – weil er als Gerechter stirbt und Gutes erwarten darf.
So kann er getrost und ohne Groll sein Leben (seinen »Geist«) in Gottes Hände legen. Lukas zeichnet hier ein Vorbild für das Sterben eines Christenmenschen. Der erste, der diesem Vorbild folgen wird, ist der Märtyrer Stephanus (Apostelgeschichte 7,59).
Jesu Wort ist ein Zitat aus einem Psalm. Das verbindet die Markus- und die Lukasfassung des Sterbens Jesu. Während es bei Markus (bzw. Matthäus) jedoch ein Klagepsalm ist (wenn auch mit vertrauensvollem Ausklang), ist es bei Lukas mit Psalm 31 ein Psalm, bei dem das Vertrauen in Gott von Anfang an den bestimmenden Ton ausmacht und den fromme Juden als Nachtgebet sprechen.
5. Johannes 19,26-27
»Frau, siehe, das ist dein Sohn. … Das ist deine Mutter.«
Jesus spricht diese Worte vom Kreuz herab zu seiner Mutter und zum Jünger, den er liebhatte. Dieser Jünger ist eine Figur, die nur im Johannesevangelium vorkommt. Dieser tritt in Johannes 13,23 unvermittelt auf und von ihm heißt es in Johannes 21,20-25, er habe das Evangelium geschrieben.
Jesus handelt in dieser Szene herrschaftlich. Er ist kein Opfer, sondern behält die Fäden in der Hand. Der Ausleger Ulrich Wilckens spricht von einer »letztwilligen Verfügung«. Dies passt zur Deutung des Kreuzestodes im Johannesevangelium: dieser Tod ist keine Erniedrigung, wie sie es z. B. im Markusevangelium oder bei Paulus ist, sondern Jesus wird ans Kreuz erhöht, weil Johannes Kreuz und Auferstehung nicht als zwei verschiedene Stationen auf dem Weg Jesu sieht, sondern radikal zusammendenkt.
Der Jünger tritt in dieser Szene an die Stelle Jesu. Denkt man dies zusammen mit der Theorie, der Jünger habe das Evangelium geschrieben, kann man das folgendermaßen deuten: der irdische Mensch Jesus verlässt die Welt, es bleibt die im Evangelium festgehaltene Botschaft zurück, an die wir Heutigen uns halten können und sollen. Zugleich steht der namenlose (!) Jünger für alle Jünger Jesu, also für die Kirche. Dadurch, dass sie über die Identifikation mit dem Jünger zu Kindern seiner Mutter werden, hebt Jesus die Christen und Christinnen in den Stand der Geschwister Jesu und der Geschwister untereinander. Bis heute sprechen sich Christ*innen mit »Bruder« und »Schwester« an.
6. Johannes 19,28
»Mich dürstet!«
Kurz vor seinem Tod spricht Jesus ein zweites Mal vom Kreuz herab. Wie im Markus- (bzw. Matthäus-) Evangelium wird in Jesu letzter Stunde eine Spur ins Alte Testament gelegt, das heißt: Jesu Einbettung ins Judentum hervorgehoben.
Das Wort »Mich dürstet!« sagt Jesus, „damit die Schrift (also das Alte Testament) erfüllt würde. Wiederum sind es auch hier die Psalmen, auf die Bezug genommen wird. Zum einen ist an Psalm 69,22b zu denken. Dort – in einem Klagepsalm eines für Gott Eifernden – heißt es: »Für meinen Durst gaben sie mir Essig zu trinken«. So geschieht es im darauffolgenden Vers 29. In Psalm 22, aus dem Jesus nach Markus 15,34 zitiert, wird in Vers 16 vom Durst des Klagenden im Zusammenhang der Todesqual geschrieben: »Meine Zunge klebt an meinem Gaumen, in den Staub des Todes legst du mich«.
Wie Lukas macht auch Johannes deutlich, dass sich das, was hier am Kreuz geschieht, in Übereinstimmung mit dem Plan Gottes befindet; Johannes stellt darüber hinaus klar: dieser Plan Gottes ist in der Heiligen Schrift, dem Alten Testament, zu finden.
7. Johannes 19,30
»Es ist vollbracht.«
In diesem Wort wird ausgesprochen, dass im Tod Jesu seine Sendung an ihr telos gekommen ist. Telos ist das griechische Wort für Ende und Ziel.
Sie ist an ihr Ende gekommen, weil am Kreuz der Weg des irdischen Menschen Jesus endet. Jesus stirbt, er kann auf Erden nicht mehr seine Jünger lehren, trösten und mahnen, und er kann keine Zeichen und Wunder mehr tun.
Sie ist an ihr Ziel gekommen, weil Jesus nun zum Vater zurückkehrt, der ihn gesandt hat (vgl. Johannes 4,34; 5,36; 17,4). Im Tod erfüllt sich nicht nur der Einklang des Willens des Sohnes mit dem Willen des Vaters (Johannes 12,27-28; vgl. 10,30: »Ich und der Vater sind eins«), sondern auch die Liebe des »Hirten« für die »Schafe« (Johannes 10,11+15; vgl. 13,1; 15,13), in der die Liebe des Vaters zur Welt (Johannes 3,16) ihren höchsten Ausdruck findet.
Der Tod Jesu wird also bei Johannes so gedeutet, dass er Selbsthingabe ist: Jesus gibt sich in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters hin, und zwar aus Liebe zu den Menschen. In seiner Selbsthingabe kommt die Liebe des Vaters zu seinen Kindern zur Erfüllung. Der Tod Jesu bewirkt, dass Jesus nicht nur den Tröster, den Heiligen Geist, senden kann (Johannes 14,23-27), sondern dass er auch die Seinen zu sich ziehen kann (Johannes 14,1-6).
Die Liebe, mit der Jesus die Seinen liebt, soll auch unter den Christinnen und Christen lebendig sein (13,34-35).
In der Selbstbestimmtheit, mit der Jesus hier würdevoll in den Tod geht, ähnelt die Johannes-Passion der Leidensgeschichte nach Lukas.
Die sieben Worte Jesu am Kreuz sind vielfach in der Kultur, besonders der Musik, aufgegriffen worden. Bekannte Vertonungen stammen von Heinrich Schütz (1645) und Joseph Haydn (in verschiedenen Versionen zwischen 1787 und 1796: Orchester, Streichquartett, Klavier, Oratorium). In jüngerer Zeit hat u.a. Sofia Gubaidulina (*1931) die sieben Worte vertont.
III. Kreuzestheologie
Hon.-Prof. Dr. Klaus Grünwaldt
Mit dem Begriff Kreuzestheologie bezeichnet man eine Theologie, die das Kreuz Jesu in ihr Zentrum stellt.
Die Kreuzestheologie des Apostels Paulus im Neuen Testament
Ein zentraler Text zum Verständnis dieser Theologie ist Galater 2,19-20: »Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.«
Zunächst konstatiert Paulus für sich das Sterben, den Tod. Seinen Tod führt er auf das Gesetz zurück: »Ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben.« Was meint er damit? Auf die Spur des Verstehens führt die Fortsetzung des Verses: »Ich bin mit Jesus mitgekreuzigt.« Jesus ist aufgrund der Forderung des Gesetzes gestorben, unter das er, bedingt durch seine konkrete geschichtliche Existenz als Jude, gestellt war (Galater 4,4). Mit diesem Geschehen weiß sich Paulus aufs innigste verbunden, ja er weiß sich eins mit diesem Geschehen.
Christus ist aber nicht als jemand gestorben, der seine eigenen Sünden zu tragen hätte, sondern Christus sind von Gott die Sünden der sündigen Menschen aufgeladen worden. Während Paulus für seine eigenen Sünden stirbt, ist Christus für die Sünden des Paulus und die Sünden der Menschheit gestorben.
weiterlesen...
Wenn also Paulus sagt, er sei mit Christus mitgekreuzigt worden, dann ist damit gemeint, dass mit dem Christus Jesus auch der Mensch und Sünder Paulus gestorben ist. Am Kreuz steht die Identität, das Ich des sündigen Menschen auf dem Spiel; am Kreuz erfährt der Sünder sein Gericht als Gericht Gottes.
Die der Sünde verfallene Welt hat den Tod verdient, aber aus Liebe zu seinen Geschöpfen hat Gott entschieden, die Welt nicht noch einmal wie in der Sintflut (1. Mose 6-9) dem kollektiven Tod auszuliefern. Stattdessen hat er selbst den Tod am Kreuz auf sich genommen.
Das neue Leben der Geretteten nimmt Galater 2,20 in den Blick. Doch in dem Jubelklang über das geschenkte Leben sind die Zwischentöne mitzuhören. Es ist nicht der sündige Mensch selbst, der sich das Leben als sein Verdienst zurechnen kann, sondern es ist das Leben des auferweckten Jesus Christus, das dem gekreuzigten Menschen als sein Leben zugerechnet wird: »Nicht ich, sondern Christus lebt in mir.« Dieses neu angerechnete Leben ist möglich, weil es das »Lebenselixier« des Glaubens gibt, das ein Leben im vergänglichen, dem Tod geweihten Fleische zu einem Leben macht, das den Namen »Leben« wirklich verdient.
Aus dem Römerbrief erfahren wir, in welchem Akt sich das Sterben und der Neubeginn des Lebens ereignet. In Römer 6,6 sagt Paulus: »Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen.«
Die Taufe ist weder ein Symbol für das Kreuzesgeschehen noch seine Wiederholung, sondern die Taufe vergegenwärtigt das Kreuz. Die Taufe holt für den Täufling das Kreuz Jesu Christi in die Gegenwart und eignet es ihm auf diese Weise zu.
Der in jedem Menschen fortlebende Adam, der Sünder, ist mit Christus gekreuzigt worden oder – im Bild der Taufe – im Taufwasser ertränkt worden, damit der Leib nicht mehr die Sünde zur Wirkung kommen lassen soll. Mit »Leib« meint Paulus das irdisch-geschöpfliche Dasein des Menschen. In der Taufe wird der irdische Leib Gott übereignet, auf dass er ihn von der Sünde reinige. Man darf sich dies aber nicht so vorstellen, dass dies ein einmaliger Akt wäre und der Mensch nach der Taufe die Sünde für immer los wäre. Der Mensch bleibt auch nach der Taufe Sünder. »Die Erbsünde wird in der Taufe vergeben, nicht dass sie nicht mehr sei, sondern dass sie nicht zugerechnet werde«, sagt der Kirchenvater Augustin (354-430), und Luther antwortet auf die Frage »Was bedeutet denn solch Wassertäufen« im Kleinen Katechismus: »Es bedeut, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reu und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sunden und bösen Lüsten.«
In der Taufe wird also der Sünder insofern mitgekreuzigt, als ihm der Tod Jesu Christi vergegenwärtigt und damit zugeeignet wird. Für das Leben eines Christenmenschen gilt es, sich die Taufe im Glauben täglich neu anzueignen.
Als letzter Text soll noch auf 2. Korinther 5,14-15 eingegangen werden. »Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist.«
Hier kommt die Kategorie der Stellvertretung zur Sprache, die Rede von Jesu stellvertretendem Tod für die Menschen. Indem Jesus an die Stelle der Menschen tritt, die doch eigentlich sterben sollten, gelten diese Menschen, für die Jesus stellvertretend eintritt, vor Gott als gestorben. Gott rechnet den Menschen, für die Jesus stirbt, seinen Tod als ihren Tod an. So sehr dies ein Akt der Liebe ist, wird aber wiederum zwischen den Zeilen auch gesagt, dass die Menschheit den Tod verdient. Dass Jesus diesen Tod für sie (für uns) auf sich nimmt, ist reine Gnade.
Der zweite Satz zieht die Konsequenz aus dem ersten. Wie Gott uns den Tod Jesu als unseren Tod anrechnet, so rechnet er uns Jesu Leben als unser Leben zu. Für uns heißt das, nicht so zu leben, als sei unser Leben unser Verdienst. Damit ist ausgeschlossen, dass wir uns rühmen, sondern unsere Aufgabe als Christen ist es, auf Jesus Christus hin zu leben und das Evangelium weiterzugeben, so wie Paulus es tut.
Die Wiederentdeckung der Theologie des Kreuzes durch Martin Luther
Luther beobachtet in seiner Zeit in Kirche und Gesellschaft (welche beiden zu seiner Zeit noch vereinigt waren) einen Zwang zur Selbstverwirklichung und Selbstrechtfertigung. Menschen sahen sich gefordert, sich ihren Platz vor Gott und in der Welt zu erarbeiten. Dies hat Luther vor allem in der Seelsorge, aber auch ganz existenziell in seiner eigenen Person wahrgenommen: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?!
Seine Antwort fand Luther in der Bibel, vor allem in den Schriften des Apostels Paulus, dessen Kreuzestheologie wir eben in ihren Ansätzen kennengelernt haben. Das Kreuz ist einerseits Zeichen des Gerichtes Gottes über die Welt, Zeichen dafür, dass Gott die Sünde nicht ertragen will und sie darum fortschafft. Das Kreuz ist aber andererseits Zeichen der unergründlichen Liebe Gottes, die in seiner unverdienten Vergebung der Sünden konkrete Gestalt gewinnt.
So wird die Kreuzestheologie gleichsam zur Denkform der Theologie bei Luther schlechthin. Das Kreuz durchdringt seine Theologie in ihrer Struktur wie in ihrer konkreten Ausformung. Einige zentrale Gedanken seien genannt:
Gott offenbart sich nicht in Herrlichkeit, sondern er nimmt sich zurück und offenbart sich in der Niedrigkeit des Kreuzes. Im Kreuz erschließt sich Gottes Liebe zu den Menschen.
Gott offenbart sich also sub contrario – unter dem Gegenteil: der herrliche Gott im schrecklichen Kreuzestod; seine Liebe in einem brutalen menschlichen Akt; seine Gerechtigkeit im ungerechten Urteil über Jesus – kurz: seine Offenbarung geschieht so, dass er sich verhüllt, das heißt: der Welt nicht eindeutig zu erkennen gibt.
Am Kreuz geschieht ein »wunderbarer Tausch und fröhlicher Wechsel« zwischen Christus und dem Sünder. In der Auslegung von Galater 2,19 und 20, die wir oben besprochen hatten, spricht Luther von »eine(r) Person, die sich nicht von Christus scheiden kann, sondern andauernd an ihm anhängt und sagt: ‚ich bin wie Christus‘, und Christus sagt: ‚ich bin wie jener Sünder, weil er an mir hängt.‘« Das Weihnachtslied sagt entsprechend: »Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein …« (Ev. Gesangbuch Nr. 27, Strophe 5).
Der durch das Kreuz verurteilte und zugleich erlöste Mensch ist »simul iustus et peccator – zugleich Gerechter und Sünder«. Sünder ist er tatsächlich, nämlich weil er unweigerlich und fortgesetzt sündigt, schon dadurch, dass er in dieser Welt lebt und handelt und permanent Dinge tut, die er nicht tun darf und Dinge unterlässt, die er als Christ tun müsste. Er ist aber auch Gerechter, weil Christus am Kreuz die Konsequenz seiner Taten und Unterlassungen, nämlich die Strafe, bereits auf sich genommen hat. Im Glauben eignet sich der Mensch den Freispruch Gottes an und lebt schon hier und heute in der Hoffnung, ja der Gewissheit der Erlösung.
Kritik in der jüngeren Theologie
Eine Anfrage ist schon durchaus älter. Sie geht im Grunde auf Kant zurück, der die Figur der Stellvertretung in der Schuldübernahme in Frage stellt. Kant zweifelt nicht daran, dass der Mensch böse ist. Im Gegenteil: Das Böse im Menschen ist radikal, weil es an der Wurzel der Moral sitzt und sie verdirbt. Die moralische Gesinnung des Menschen ist korrumpiert. Der Mensch ist moralisch gesehen, das heißt im Blick auf die allen seinen Taten zugrundeliegende Gesinnung, von Grund auf verdorben, selbst wenn er äußerlich betrachtet sein Leben recht passabel gestaltet. So und darum häuft er Schuld auf sich. Aber diese Schuld ist eine höchstpersönliche. Sie ist die Schuld genau des Menschen, der schuldig geworden ist, und nicht übertragbar auf jemand anderen – auch nicht auf Christus. Damit bestätigt Kant den Propheten Ezechiel, der in Kapitel 18 sagt, dass ein jeder seine Schuld selbst tragen muss. Kants Lösung besteht darin, dass er die äußeren Prozesse der Schuldübernahme ins Innere des Menschen verlegt. Im Bilde gesprochen: der alte Mensch stirbt und übernimmt damit die Konsequenz seiner Schuld; an seine Stelle tritt ein neuer Mensch.
Weiter geht die Kritik feministischer Theologie, z. B. Dorothee Sölles, aber auch Elisabeth Schüssler Fiorenza, Rosemarie Ruether, Helene Schüngel-Straumann und anderer an der Kreuzestheologie. Kritikpunkte sind:
- Die Kreuzestheologie vermittelt ein männlich-patriarchalisches, ja sadistisches Gottesbild. Was ist das für ein Gott, der ein Opfer braucht, um sich versöhnen zu lassen?
- Wo die Vorstellungen von Opfer und Liebe miteinander verquickt werden, wird ein höchst gefährliches Beziehungsmodell transportiert, unter dem Frauen jahrhundertelang z. B. als Töchter und Ehefrauen gelitten haben.
- Das Stilisieren oder Hochschätzen von Leiden zementiert ausbeuterische Strukturen in der Familie, aber auch in der Gesellschaft. Von hier aus gesehen besteht der marxistische Vorwurf, Religion sei Opium fürs Volk, durchaus zu Recht.
- Wo das Leiden als Vorbild hingestellt wird, dem ein guter Christenmensch nachzustreben habe. Dies »diente dazu, Frauen klein und unterdrückt zu halten: Sie forderte sie auf, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und z.B. einen gewalttätigen Ehemann, sexuelle und psychische Gewalt, gesellschaftliche Diskriminierung und unerfüllte Wünsche nach Selbstverwirklichung geduldig zu ertragen.« (Doris Strahm)
- Wo Leiden in dieser Weise hochstilisiert wird, wächst eine Kultur der Lust- und Lebensfeindlichkeit. Wo bleibt die Lebensfreude, wo der Spaß? Gott ist ein Gott des Lebens und der Lebenden, darum wollen wir keinen toten Körper anbeten.
Theologie, die im Gefolge dieser (und anderer) Kritikpunkte insbesondere das Verständnis des Todes Jesu als den eines Sühnopfers ablehnt, hebt stärker auf das Kreuz als Kritik an Gewalt und Unterdrückung sowie die Betonung des Todes als Akt der Liebe und der Solidarität mit den Leidenden ab.